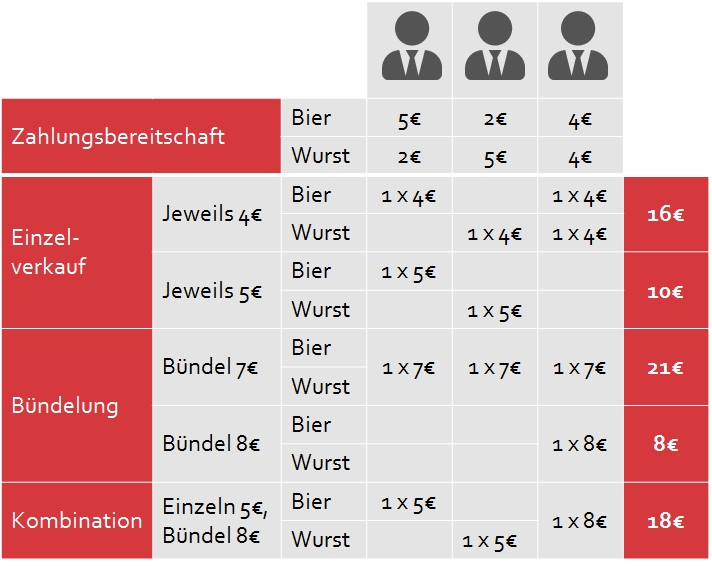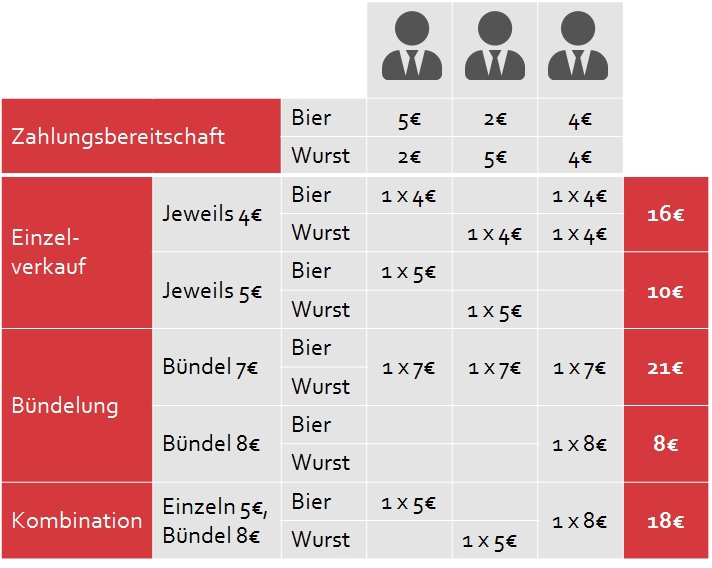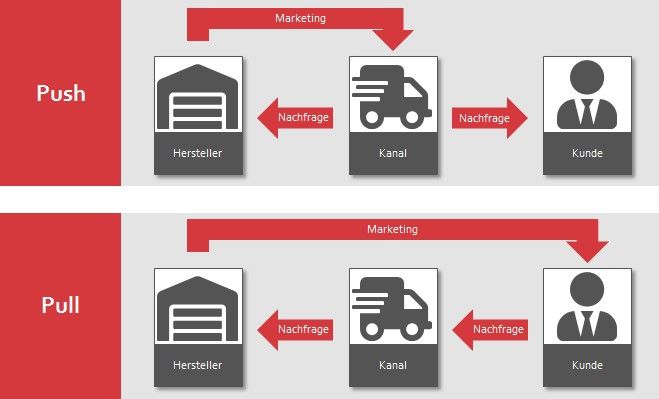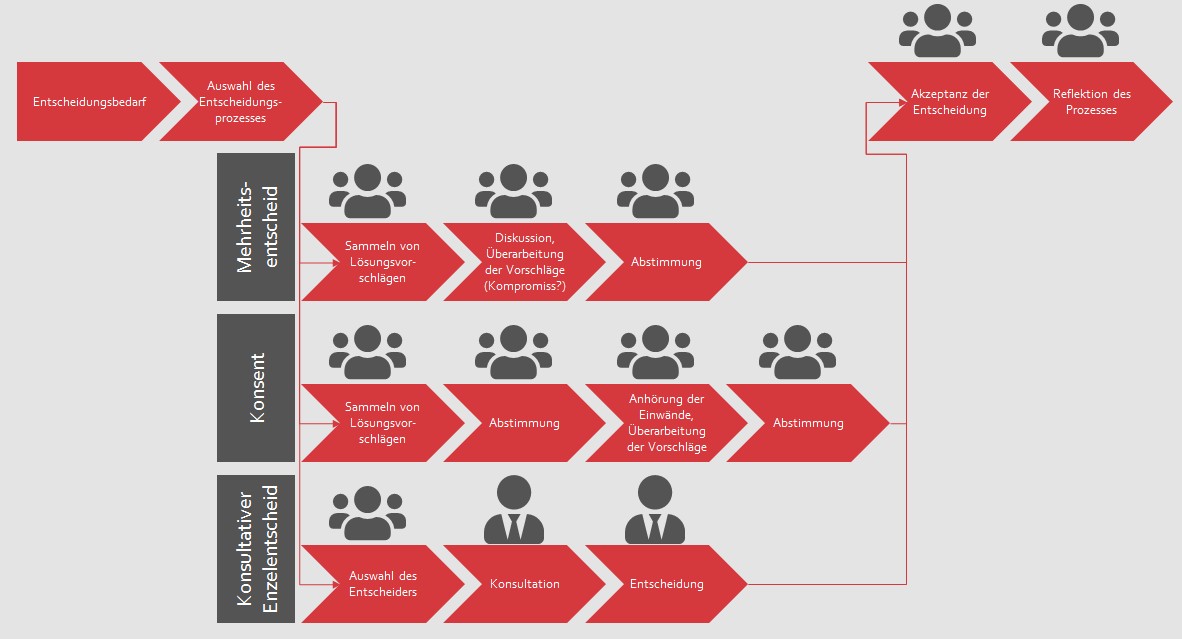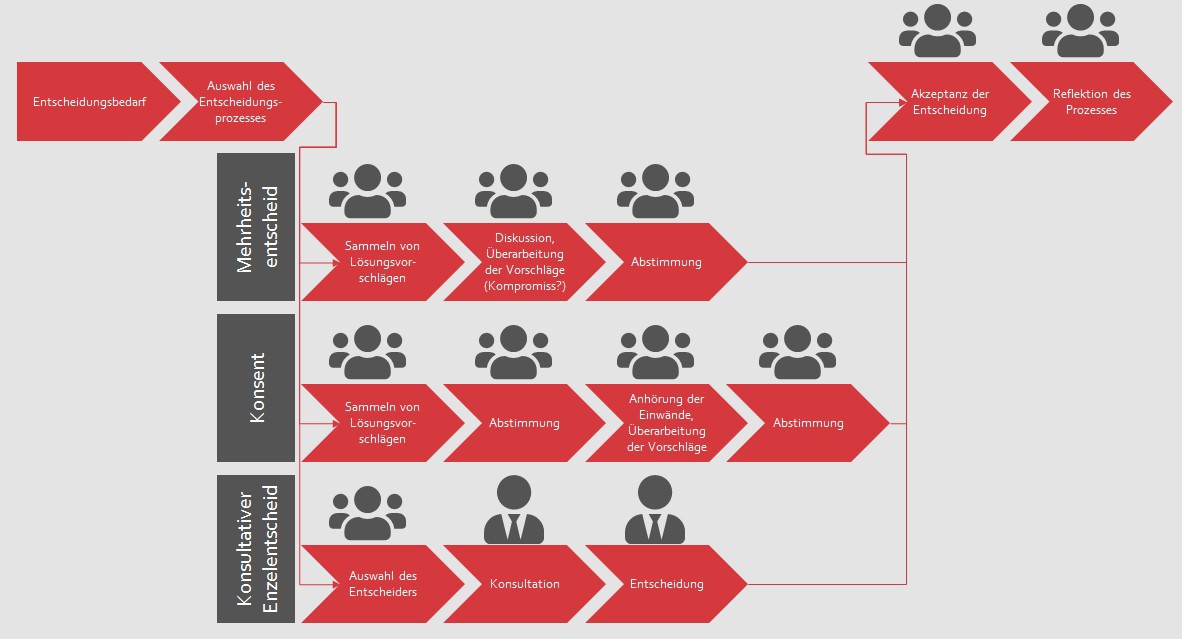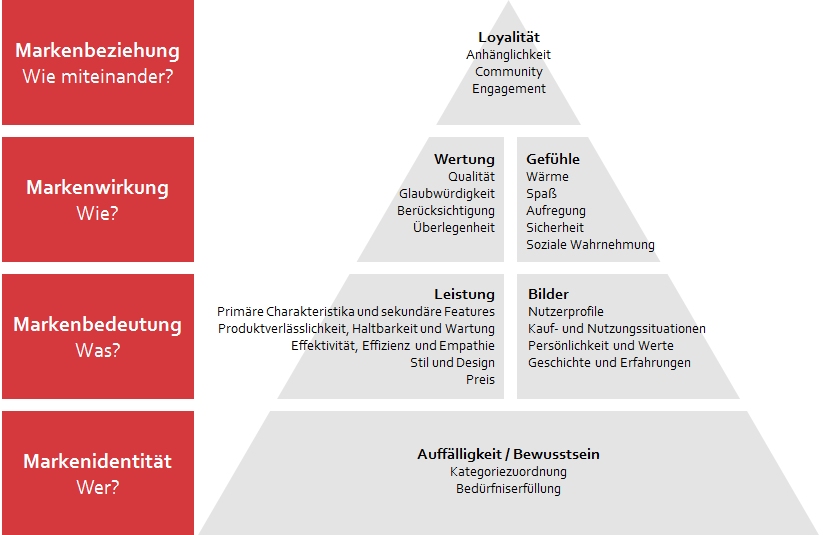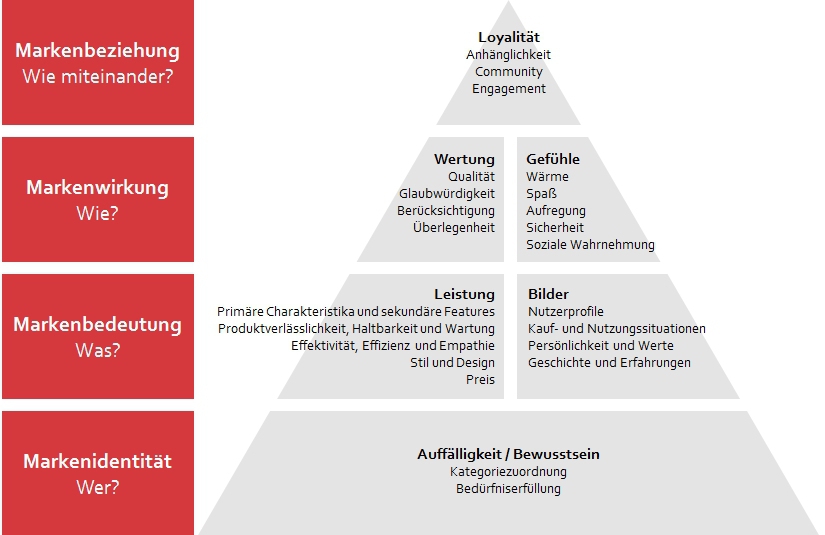Marketingmanagement IX: Agile Perspektive
Nachdem ich acht Teile über einen Rahmen zum Marketingmanagement geschrieben habe, ist es an der Zeit, diese Theorie aus einer agilen Perspektive zu beleuchten. Dieser Beitrag ist daher der neunte und letzte Teil der Serie, zum Teil I geht es hier.
Kundenfokus
Bevor ich mich mit den in den vorigen Teilen dargestellten Konzepten des Marketingmanagements auseinandergesetzt hatte, hatte ich eine relativ negative Meinung zu Marketing. Ich glaubte, bei Marketing ginge es darum, ein Produkt gut zu vermarkten, um eventuelle Schwächen des Produktes zu kompensieren. Marketing war für mich also eine Form des Verwirrens des Kunden, der aufgrund von Marktschreiern plötzlich nicht mehr die für ihn optimale Entscheidung trifft. Ganz übertrieben gesagt war Marketing für mich eine Form des Lügens.
Ich weiß nicht, wie dieses Bild in meinem Kopf entstanden war. Vielleicht bin ich althergebrachten Vorurteilen auf den Leim gegangen. Ganz sicher wusste ich es nicht besser. Vermutlich habe ich Marketing auf den einen Punkt reduziert, der mir begegnet, nämlich die Kommunikation als Teil der vier Ps (siehe Teil I, Bereich Handlung). Mittlerweile muss ich meine Meinung revidieren, denn mir ist klar geworden, dass Marketingmanagement deutlich mehr umfasst.
Besonders deutlich ist, dass der Kunde den Mittelpunkt aller Aktivitäten darstellen muss. Dies ist eine Gemeinsamkeit mit der agilen Perspektive, die ebenfalls einen radikalen Kundenfokus fordert. Dieses Grundkonzept des Marketingmanagements hat mir daher sehr gut gefallen.
Allerdings sollte nicht vergessen werden, dass die Beeinflussung des Kunden trotzdem eine Rolle spielt. In Teil II wird dies diskutiert, hier werden Kaufentscheidungsprozesse und Einflussmöglichkeiten diskutiert.
Feedbackschleifen
Ein zentraler Gedanke agiler Praxis ist die der Feedbackschleife. Je nach Geschmack wird dies mit inspect & adapt (deutsch: Beobachten und Anpassen) bezeichnet, oder über einen der Punkte des agilen Manifestes beschrieben: Responding to change over following a plan (deutsch: Reagieren auf Veränderung ist wichtiger als stur einem Plan zu folgen).
Die dahintersteckende Idee ist, dass es in einer komplexen Welt im Allgemeinen, und in komplexen Produktentwicklungen im Besonderen, nur selten möglich ist, Dinge weit im Voraus exakt zu planen. Bei Innovationsprozessen ist es dagegen sehr häufig so, dass der dritte Schritt extrem von den Ergebnissen des ersten und zweiten Schrittes abhängig ist. Diese Abhängigkeit bezieht sich sowohl auf eine inhaltliche als auch auf eine zeitliche, personelle und organisatorische Abhängigkeit. Das bedeutet, es ist weder klar, was getan werden muss, noch wann, noch von wem, noch ob die vorhandene Struktur dies überhaupt erlaubt.
Das klingt nach Chaos? Leider ist dieser Vorwurf nicht komplett von der Hand zu weisen. Allerdings ist dies eine Frage der Perspektive. Wenn die Perspektive ist, dass alles, das weniger als zu 100% in Voraus exakt planbar ist, Chaos bedeutet, dann stimmt dieser Vorwurf. Wenn Chaos bedeutet, dass im Voraus unbekannt ist, welches der beste Weg zu einem Ziel ist, auch dann stimmt dieser Vorwurf. Wenn Chaos bedeutet, dass niemand weiß, was er machen soll, und alle plötzlich wie kopflose Hühner durch die Gegend laufen, dann stimmt dieser Vorwurf nicht. Die mittlere Beschreibung trifft es am besten: Allen ist das Ziel bekannt, aber der beste Weg dorthin muss erst noch gefunden werden. Ist das Chaos? Meiner Meinung nach: Nein.
Wenn das Ziel bekannt ist, aber der Weg noch nicht, dann funktioniert Agilität am besten. Diese Beschreibung entspricht dem Horizont 2 im Drei-Horizonte-Modell für Innovationen, darauf möchte ich an dieser Stelle nicht weiter eingehen. Daher nur kurz der wichtigste Unterschied zum ersten Horizont: Der erste Horizont entspricht im Prinzip der Serienfertigung. Am Fließband weiß jeder genau, was wann wie zu tun ist, um das beste Produkt zu liefern. Dies ist im Detail im Voraus planbar, und hier ist Agilität nicht nötig, aber so funktioniert Innovation ja nicht. Innovative Produktentwicklung beinhaltet immer Unplanbarkeit, die das Reagieren auf Veränderung erfordert.
Dieser Kerngedanke der Unplanbarkeit wird in vielen agilen Frameworks, zum Beispiel Scrum, so interpretiert, dass bewusst nicht langfristig exakt geplant wird, sondern nur kurzfristig. Die langfristige Planung wird dagegen durch Ziele, Visionen und Leitplanken sichergestellt. Gleichzeitig wird durch Feedbackschleifen sichergestellt, dass die kurzfristige Planung und die Ergebnisse dieser kürzeren Entwicklungsschritte auch tatsächlich den erhofften Mehrwert liefern.
In den vorgestellten Modellen des Marketingmanagements scheint die Philosophie eine andere zu sein. Es scheint so, als wäre dies auf eine langfristige Planung ausgelegt, als könne man die einzelnen Schritte einfach in der richtigen Reihenfolge durchlaufen, und dann sei alles gut. Der Kunde spielt zwar eine Rolle, aber er wird nur ganz am Anfang intensiv analysiert. Danach wird der Markt segmentiert, ein Produkt entwickelt, auf den Markt gebracht und beworben. Aber was ist, wenn dieser Prozess so lange dauert, dass sich die Kundenbedürfnisse verändert haben? Darauf gibt es keine vernünftige Antwort. In der agilen Welt kann dies nicht passieren, da durch kurze Feedbackschleifen ständig geprüft wird, ob der Entwicklungsstand noch zu den Kundenbedürfnissen passt.
Ganz plakativ formuliert könnten die beiden Philosophien wie folgt beschrieben werden: Entweder glaubt man daran, dass durch hartes Nachdenken die perfekte Lösung gefunden werden kann, oder man überprüft die eigenen Hypothesen regelmäßig. Die zweite Variante wird oft als iterativ beschrieben, manchmal auch als empirisch. Empirisch klingt sehr wissenschaftlich, und Harald Lesch, Astrophysiker und Fernsehmoderator, hat einmal gesagt: „In den Naturwissenschaften irren wir uns empor.“ Das Zitat ist nicht wörtlich wiedergegeben, aber im Kern geht es darum, dass durch die regelmäßige Überprüfung der Hypothesen durch kurze Feedbackschleifen am Ende eine bessere Lösung entsteht.
Zusammenfassung
Obwohl das Marketing-Framework klar tayloristisch geprägt ist, sind viele der zentralen Gedanken problemlos in der agilen Welt anwendbar. Besonders der Fokus auf die Kundenbedürfnisse hat mir sehr gut gefallen. Gleichzeitig finde ich es gut, dass das Marketing-Framework nicht nur auf die Produktentwicklung reduziert ist, sondern umfassender angelegt ist. Mir persönlich hat die Beschäftigung mit dieser Materie daher deutlich weitergeholfen.
Dies ist das Ende dieser Serie zu Marketingmanagement. Daher folgt nun ein kleiner Teaser zur nächsten Serie. Deren Arbeitstitel lautet: Führung und Einfluss.